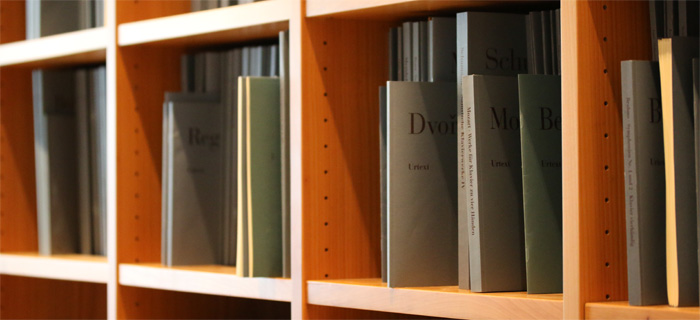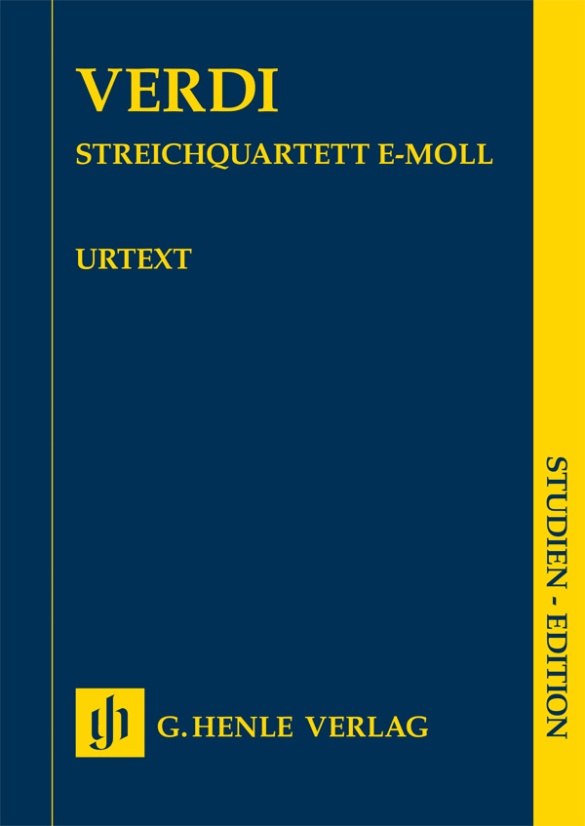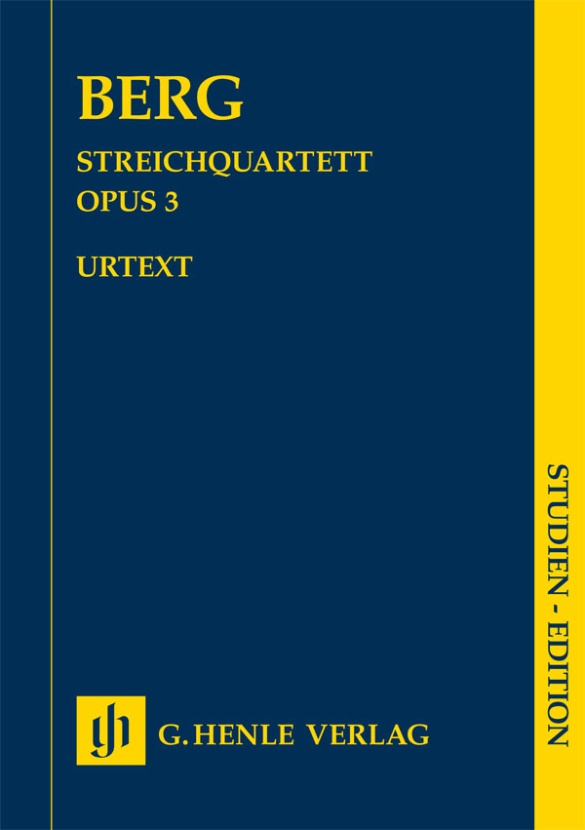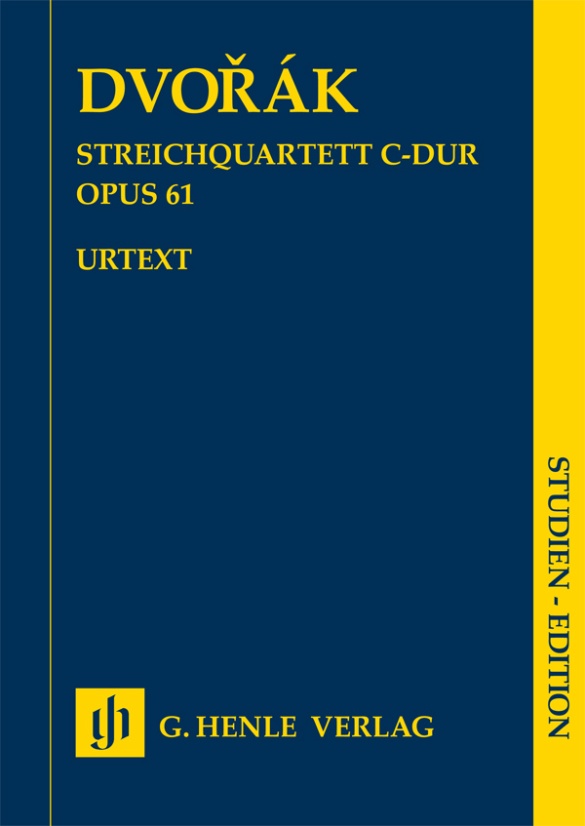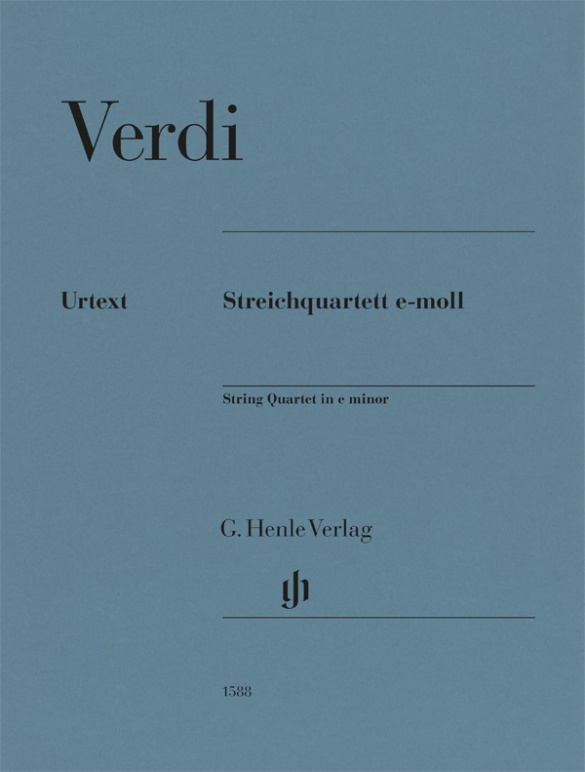
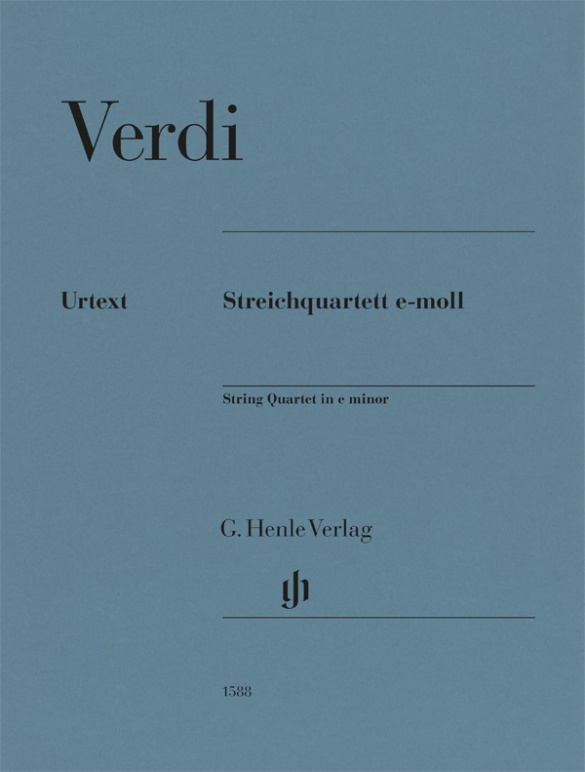
Giuseppe Verdi
Streichquartett e-moll
Der Name Verdi ist im Bewusstsein der Musikwelt so fest mit seinem Opernschaffen verbunden, dass die Beiträge zu anderen Gattungen leicht übersehen werden. Sein einziges Kammermusikwerk verdankt sich einer Zwangspause in Neapel im Frühjahr 1873 wegen verschobener Opernproben, die der Komponist zur großen Überraschung seines Umfelds zur Niederschrift eines Streichquartetts nutzte. Trotz der Orientierung an den Quartetten der Wiener Klassik gelingt Verdi ein eigenständiger, origineller Beitrag zu dieser Gattung, der mit zahlreichen melodischen, harmonischen und kontrapunktischen Finessen keinen Zweifel am kompositorischen Anspruch lässt. Die italienische Erstausgabe dient als Grundlage der Henle-Urtextausgabe, für die aber auch wichtige Nebenquellen wie das Partiturautograph oder die französische Erstausgabe herangezogen werden.
Mehr zu dieser Ausgabe im Henle-Blog.
Inhalt/Details
Über den Komponisten

Giuseppe Verdi
Bedeutendster ital. Opernkomponist im 19. Jahrhundert. Er beherrschte 50 Jahre lang konkurrenzlos die Opernbühnen Italiens. Zudem war er auch nationale Identifikationsfigur, dessen Name zum Schlagwort für die ital. Einigung genommen wurde (Viva VERDI steht für Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia). Seine frühen Opern wurden deshalb verstärkt politisch gedeutet und mit den ital. Einheitsbestrebungen in Verbindung gebracht. Er arbeitete hauptsächlich mit den Librettisten Solera, Piave und Cammarano, später mit Boito, in Paris auch mit Scribe („Les vêpres siciliennes“) zusammen.
| 1813 | Er wird am 9. oder 10. Oktober in Roncole bei Busseto geboren. Unterricht noch vor seinem vierten Lebensjahr beim ortsansässigen Priester, mit 9 Jahren Organistenstelle, mit 11 Besuch des Gymnasiums in Busseto, mit 12 Unterricht beim Kapellmeister an S. Bartolomeo, Ferdinando Provesi. |
| 1832 | Der Versuch, ins Mailänder Konservatorium aufgenommen zu werden, scheitert aus formalen Gründen. Stattdessen Unterricht beim „Maestro concertatore“ der Scala, Vincenzo Lavigna, der ihn auch in die musikalische Welt Mailands einführt. |
| 1836 | Rückkehr nach Busseto, wo er eine Stelle als „Maestro di musica“ bekommt; Kompositionen für die örtliche philharmonische Gesellschaft. |
| 1839 | Verdi geht wieder nach Mailand, wo 1840 seine erste Oper, „Oberto, conte di San Bonifacio“, aufgeführt wird auf ein Libretto Soleras, mit dem er auch im Folgenden zusammenarbeitet. Der Erfolg führt zu drei weiteren Opernaufträgen für Mailand. |
| 1840 | Die Buffo-Oper „Un giorno di regno“ hat keinen Erfolg; Lebenskrise durch den Tod seiner Frau und seiner Kinder. |
| 1842 | Durchbruch mit der Uraufführung von „Nabucco“, die sich deutlich von den Werken seiner Zeitgenossen absetzt; er erhält weitere Aufträge und arbeitet seitdem mit dem Verlagshaus Ricordi zusammen. |
| 1842–53 | Es entstehen 18 Opern; er reist zwischen den Opernzentren Italiens. |
| 1843 | Uraufführung von „I lombardi alla prima crociata/Jérusalem“ in Mailand. Aufenthalt in Wien. |
| 1844 | Uraufführung von „Ernani“ in Venedig und „I due Foscari“ in Rom. Zusammenarbeit mit dem Librettisten Piave und damit Wendung zum persönlichen, verinnerlichten Drama im Unterschied zu den tableauhaften Monumentalwerken Soleras zuvor. |
| 1845 | Er kritisiert die Produktionsbedingungen an der Mailänder Scala, die er daraufhin 20 Jahre lang meidet. |
| 1847 | Uraufführung von „Macbeth“ in Florenz. Längere Reise nach London zur Uraufführung seiner Oper „I masnadieri“, danach zweijährige Reise nach Paris (Uraufführung von „Jérusalem“ 1847). |
| 1849 | Uraufführung von „La battaglia di Legnano“ in Rom, ein patriotisches Bekenntnis, und „Luisa Miller“ nach Schillers Bürgerlichem Trauerspiel „Kabale und Liebe“ in Neapel. |
| 1851 | Uraufführung von „Rigoletto“ in Venedig, der ersten Oper der „Trilogia popolare“, die heute das Repertoire bestimmt. Er bezieht einen Landsitz seiner Ahnen in der Nähe von Busseto (Sant’ Agata) mit seiner Lebensgefährtin, der Sängerin Giuseppina Strepponi. |
| 1853 | Uraufführung von „Il trovatore“ in Rom und von „La traviata“ in Venedig, der zweiten und dritten Oper der „Trilogia popolare“. |
| 1854–55 | Er weilt in Paris zu Proben und Uraufführung von „Les vêpres siciliennes“ (1855). |
| 1857 | Uraufführung von „Simon Boccanegra“ in Venedig. Vertreter in der Provinzialversammlung von Parma. |
| 1859 | Uraufführung von „Un ballo in maschera“ in Rom. Anfertigung von Regiebüchern nach frz. Vorbild, die den Theatern für ihre Inszenierungen zur Verfügung gestellt werden: Die Inszenierung wird Teil der Komposition. |
| 1861 | Ministerpräsident Camillo Benso di Cavour, mit dem Verdi befreundet ist, holt ihn ins ital. Parlament, wo er 4 Jahre lang Abgeordneter ist. |
| 1862–63 | Reisen nach Russland zur Uraufführung von „La forza del destino“ in St. Petersburg (1862). Danach Besuche in Paris, London und Madrid. |
| 1866–67 | Aufenthalt in Paris zu Proben und Uraufführung von „Don Carlos“ (1867). Ab Ende der 1860er-Jahre wieder in Kontakt zur Mailänder Scala. |
| 1871 | Uraufführung von „Aida“ in Kairo; Integration von Tänzen und großangelegten Tableaus nach frz. Vorbild. |
| 1873 | Streichquartett e-moll. |
| 1874 | „Requiem“ nach Alessandro Manzonis Tod als Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Fragen. |
| 1887 | Uraufführung von „Otello“ in Mailand; komplexe mehrschichtige musikalisch-dramatische Gestaltung. |
| 1888–89 | Einrichtung sozialer Institutionen: Er stiftet eine Klinik in Villanova und gründet in Mailand ein Haus für Musiker im Ruhestand. |
| 1893 | Uraufführung seiner einzigen späteren komischen Oper „Falstaff“ in Mailand; eine flexible Sprachvertonung statt Vertonung von Versen ist bestimmend. |
| 1898 | „Quattro pezzi sacri“ als letzte Kompositionen, die die ab 1895 komponierten Stücke vereinen: Te Deum, Stabat Mater, Vergine Maria und Ave Maria. |
| 1901 | Er stirbt am 27. Januar in Mailand. |
Angaben zur Produktsicherheit

G. Henle Verlag
Hier finden Sie die Informationen zum Hersteller des Produkts.G. Henle Verlag e.K.
Forstenrieder Allee 122
81476 München
Deutschland
info@henle.de
www.henle.com
As always with Henle publications, the parts are the most authentic version available, easy to read and clearly laid out.
Stringendo, 2024Empfehlungen
autogenerated_cross_selling
Weitere Ausgaben dieses Titels